Allgemeine Arteninformationen
Kennzeichen
- große Fledermausart mit breiter Schnauze und langen breiten Ohren
- Rückenfell hellbraun, Unterseite grauweiß, fleischfarbenes Gesicht
- Flügelspannweite 35 – 43 cm
- Gewicht 20 – 27 g
- Unterarmlänge 54 – 67 mm
Biologie und Ökologie
- Wochenstubenquartiere meist in geräumigen Dachstühlen sowie in großen Brücken
- Sommer-, Männchen- und Paarungsquartiere ebenfalls in Bauwerken, daneben werden Baumhöhlen als Tages- und nächtliche Rastquartiere genutzt
- Winterquartiere vor allem in ehemaligen Bergwerken und Stollen, daneben in unter- und oberirdischen Mauerspalten
- Wochenstubenkolonien bestehen in Mitteleuropa meist aus 50 – 1.000 adulten Weibchen
- die Weibchen bekommen im Jahr ein Junges, selten Zwillinge
- Jagd in Laub- und Nadelwäldern, bevorzugt in unterwuchsarmen Waldgesellschaften, wo bodenlebende Arthropoden leicht aufgespürt werden können, daneben über frisch gemähten Wiesen und abgeernteten Ackerflächen
- Die Jagdgebiete können 5 - 15 km, gelegentlich auch weiter vom Tagesquartier entfernt sein.
- Zwischen Sommer- und Winterquartieren legen Große Mausohren mittlere Entfernungen zwischen 100 und 300 km zurück
Überregionale Verbreitung
- gesamter europäischer Kontinent vom Mittelmeerraum bis Norddeutschland und Nordpolen und im Osten bis zur Westlichen Ukraine
- in Deutschland weit verbreitet mit Vorkommensschwerpunkten in den laubwaldreichen Naturräumen Süddeutschlands
Erhaltungszustand

günstig
Prüfung und Erfassung
Verantwortlichkeit (Auswahl)
In hohem Maße verantwortlich
Relevanz bei Eingriffen
- Forstwirtschaft
- Straßenbau
- Windkraft
Untersuchungsstandards
Wochenstubenquartiere:
- Zählungen adulter Tiere im Quartier oder beim Ausflug - Ende Mai - Anfang Juni sowie Zählungen adulter und juveniler Tiere im Quartier – Anfang – Mitte Juli
- besonders bei großen Kolonien kann es günstig sein, die Tiere im Quartier zu fotografieren und auf den Fotos zu zählen
- zusätzlich Einsatz von Lichtschranken
Winterquartiere:
- Zählungen sichtbarer Tiere 1-2-mal pro Winterhalbjahr
- Netzfänge während des Herbsteinfluges Ende August – Ende Oktobe
r
- zusätzlich Einsatz von Fotofallen
Jagdgebiete und Flugwege
- akustisch erfassbar, Begehungen mit Ultraschalldetektor im Rahmen von Untersuchungen des Gesamtartenspektrums eines Gebietes, Rufaufzeichnungen für anschließende Analyse der Sonagramme, Sicherung der Rufbelege
- mindestens 6-8 Begehungen im Zeitraum Ende April bis Anfang September, Begehungsdauer je nach Gebietsgröße mindestens 3 Stunden bis ganznächtlich
- langfristige bzw. regelmäßige ganznächtliche stationäre akustische Aufzeichnungen, z.B. an potenziellen Leitstrukturen
- Netzfänge zur Feststellung des Reproduktionsstatus
- zusätzlich telemetrische Untersuchung zur Suche nach Quartieren und Jagdgebieten sowie zur Untersuchung der Raumnutzung
Sonstige Arten-Attribute
- Besonders störungsempfindlich (TK25-Quadrant-Sechzehntel)
- Zielart Biotopverbund (Bundesland)
Vorkommen
Langfristiger Bestandstrend
starker Rückgang
Kurzfristiger Bestandstrend
- deutliche Zunahme
- gleichbleibend
Bestand
- 62 bekannte Wochenstubenkolonien mit 10 - 850 Weibchen
- 121 bekannte Winterquartiere, in denen meist 1 – 5 Tiere überwintern
- aktuelle Nachweise auf 289 MTBQ
Verbreitung und Einbürgerung
- Sachsen ist Reproduktions- und Überwinterungsgebiet
- Wochenstubenkolonien vor allem in den waldreichen Gebieten des Tief- und Hügellandes
- einzelne Sommernachweise in den Mittelgebirgslagen
- der überwiegende Teil der Winterquartiere befindet sich im Mittelgebirgsraum
Vorkommenskarte
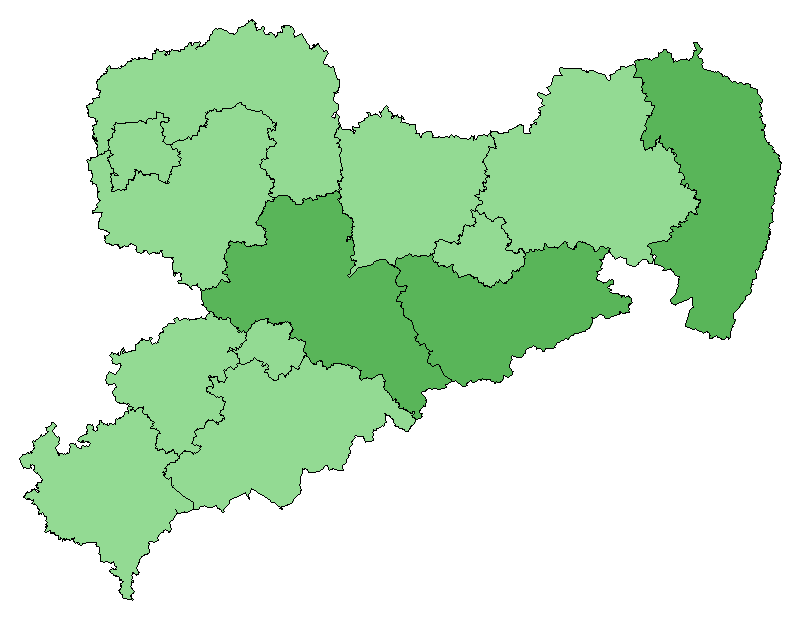
Phänologie
Phänogramm
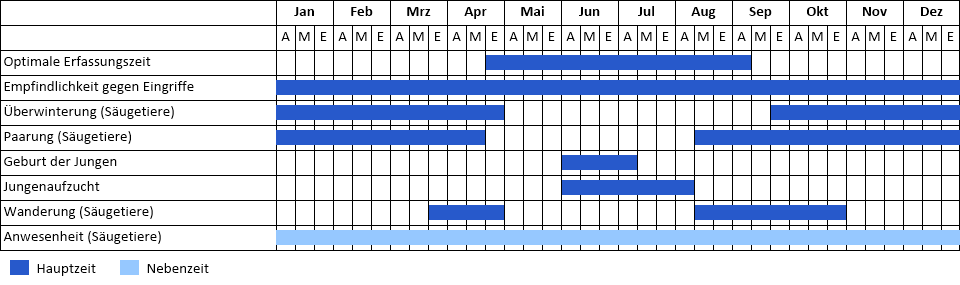
Lebensraum
- waldreiche Gebiete mit meist hohem Laubholzanteil
- Jagd in unterwuchsarmen Laubwäldern, aber auch in Nadel-Laub-Mischbeständen sowie in den Kiefernforsten des Oberlausitzer Heide- und Teichgebietes; im Offenland über frisch gemähten Wiesen oder Äckern
- Wochenstubenkolonien besiedeln geräumige Dachböden, darunter oft große Dachstühle, die Hangplatzwechsel innerhalb des Quartiers ermöglichen (z.B. zwischen dem Turm und dem Dachfirst einer Kirche) sowie Mauerspalten in Brückenbauwerken
- Sommerquartiere einzelner Tiere in Dachböden, Brücken und Baumhöhlen
- Winterquartiere meist unterirdisch, vor allem in ehemaligen Bergwerkstollen, daneben auch in Kellergewölben sowie oberirdisch in Brückenbauwerken
Lebensräume nach Artenschutzrecht
- Fortpflanzungsstätten sind Wochenstubenquartiere in Bauwerken (Gebäude, Brücken)
- Ruhestätten sind Quartiere in Gebäuden, unterirdischen Bauwerken und Baumquartieren
- Aufgrund der traditionellen Quartiernutzung gelten diese auch dann als Fortpflanzungs- bzw. Ruhestätten, wenn sie vorübergehend nicht besetzt sind.
- Die lokale Population umfasst eine Wochenstubenkolonie bzw. die Winterschlafgemeinschaft eines Winterquartiers
Habitatkomplexe
- Gebäude, Siedlungen
- Gehölze, Baumbestand
- Grünland, Grünanlagen
- Höhlen, Bergwerksanlagen
- Wälder
Habitatkomplexe Reproduktion
Management
Handlungsbedarf aus Landessicht
- Landeszielart des Biotopverbundes
Management
- Quartiererhaltung, ggfs. fledermausgerechte Sanierungen mit fachkundiger Betreuung
- Sicherung der Störungsfreiheit in Winterquartieren
- Verzicht auf Pestizide in Land- und Forstwirtschaft
- Erhaltung von großräumig unzerschnittenen Waldgebieten
Gefährdungen
- Quartierzerstörungen durch Abriss oder nicht fledermausgerechte Sanierung
- Einsatz für Fledermäuse toxischer Holzschutzmittel in Quartieren
- Störungen in Winterquartieren
- Insektizideinsatz in Forst- und Landwirtschaft
- zunehmende Lebensraumfragmentierung durch Straßen
Sonstiges
Literatur
Arlettaz, R. (1995): Ecology of the sibling mouse-eared bats (Myotis myotis and Myotis blythii). Zoogeography, niche, competition and foraging. - Martigny, Horus Publishers.
Audet, D. (1990): Foraging behaviour and habitat use by a gleaning bat, Myotis myotis (Chiroptera: Vespertilionidae). - J. Mammal. 71 (3): 420-427.
Dietz, C., O. v. Helversen & D. Nill (2007): Handbuch der Fledermäuse Europas und Nordwestafrikas. Franckh-Kosmos Verlags GmbH, Stuttgart.
Güttinger, R. (1997): Jagdhabitate des Großen Mausohrs (Myotis myotis) in der modernen Kulturlandschaft. – BUWAL-Reihe Umwelt 288. Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft, Bern.
Hertweck, K. & B. Plesky (2006): Raumnutzung und Nahrungshabitate des Großen Mausohrs (Myotis myotis) in der östlichen Oberlausitz (Sachsen, Deutschland). – Säugetierkundl. Inf. 5: 651–662.
Meschede, A. & K.-G. Heller (2000): Ökologie und Schutz von Fledermäusen in Wäldern. – Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz 66, Hrsg. Bundesamt für Naturschutz.
Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Hrsg.): Atlas der Säugetiere Sachsens. - Naturschutz und Landschaftspflege, 413 S.
Schober, W. (2004). Ergebnisse einer 15-jährigen Beringungsstudie an einer Mausohr (Myotis myotis) - Wochenstube. - Nyctalus (N.F.) 9: 295-304.
Schober, W & E. Grimmberger (1998): Die Fledermäuse Europas. - Franckh-Kosmos Verlags GmbH & Co., Stuttgart.
Schober, W. & Liebscher, K. (1998). Wo überwintern die Mausohren (Myotis myotis) aus den Wochenstuben in Nerchau und Steina? - Veröff. Naturkundemus. Leipzig 16: 41-55.
Steffens, R., U. Zöphel & D. Brockmann (2004): 40 Jahre Fledermausmarkierungszentrale Dresden – methodische Hinweise und Ergebnisübersicht. - Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege, 125 S.
Zahn, A. & B. Dippel (1997): Male roosting habits and mating behaviour of Myotis myotis. - J. Zool., London 243: 559-674.
Zöphel, U. (2006). Auswirkungen einer Holzschutzbehandlung mit DDT in einem Quartierverbund des Großen Mausohrs. - Mitt. sächs. Säugetierfreunde: 29-32.
Bearbeitungsstand und Bearbeiter des Artensteckbriefes
28.11.2010
Ch. Schmidt
; Aktualisierung 17.06.2014 U. Zöphel