Allgemeine Arteninformationen
Kennzeichen
- gehört zu den größten mitteleuropäischen Fledermausarten
- rotbraune Färbung, kurze runde Ohren
- Flügelspannweite 32 – 40 cm
- Gewicht 21 – 30 g
- Unterarmlänge 48 – 58 mm
Biologie und Ökologie
- Wochenstuben- und Sommerquartiere in Baumhöhlen und in Spalten von Bauwerken, häufige Quartierwechsel
- Winterquartiere in Baumhöhlen sowie in Fels- oder Mauerspalten
- Wochenstubenkolonien bestehen meist aus 20 - 60 Tieren
- die Weibchen bekommen pro Jahr 1 Jungtier oder Zwillinge
- Männchenkolonien umfassen meist bis 20 Tiere
- Jagd in allen Landschaftstypen, besonders aber über Gewässern und in Auwaldgebieten
- Die Nahrung wird im freien Luftraum und oft in großen Höhen von 10 – 50 m erbeutet. Sie setzt sich vor allem aus Zweiflüglern, Wanzen, Käfern und Schmetterlingen zusammen.
- Die schnell fliegenden Abendsegler können zwischen Tagesquartier und Jagdgebieten >10 km zurücklegen.
- gerichtet ziehende Art mit saisonalen Wanderungen zwischen 100 und 1.000 km.
Überregionale Verbreitung
- Vorkommen von Europa bis nach Ostasien, nördlich bis zum 60. - 61. Breitengrad, im Mittelmeergebiet selten und lückenhaft verbreitet
- in ganz Deutschland nachgewiesen, Wochenstubenkolonien befinden sich überwiegend in Norddeutschland sowie in Sachsen und Sachsen Anhalt
Erhaltungszustand

ungünstig-unzureichend
Prüfung und Erfassung
Verantwortlichkeit (Auswahl)
Daten ungenügend, evtl. erhöhte Verantwortlichkeit zu vermuten
Relevanz bei Eingriffen
- Forstwirtschaft
- Straßenbau
- Windkraft
Untersuchungsstandards
- Wochenstubenquartiere:
- Zählungen adulter Tiere beim Ausflug - Ende Mai - Anfang Juni
- Quartiersuche durch Beobachtungen am Quartier schwärmender Tiere bzw. von Einflügen in der Morgendämmerung sowie anhand von Soziallauten
- ggfs. Kontrollen von Fledermauskästen
Sommer-, Zwischenquartiere:
- Ausflugszählungen, Feststellung der Quartierstandorte anhand der Sozialrufe
Balz-, Winterquartiere:
- Feststellung der Quartierstandorte anhand der Sozialrufe
Jagdgebiete:
- gute akustische Nachweisbarkeit, Begehungen mit Ultraschalldetektor, Rufaufzeichnungen für anschließende Analyse der Sonagramme
- mindestens 6-8 Begehungen im Zeitraum Ende April bis Anfang September, Begehungsdauer je nach Gebietsgröße mindestens 3 Stunden bis ganznächtlich, wobei stets die Dämmerungsphasen einzubeziehen sind
- langfristige oder regelmäßige ganznächtliche stationäre akustische Aufzeichnungen
- spezielle Untersuchungsanforderungen für Planungen von Windenergieanlagen (6 Begehungen während des Frühjahrszuges, 7 Begehungen in der Wochenstubenzeit, 10 Begehungen während des Herbstzuges sowie langfristige bzw. regelmäßige ganznächtliche stationäre akustische Aufzeichnungen)
- Netzfänge zur Feststellung des Reproduktionsstatus
- Wochenstubenquartiere:
- Zählungen adulter Tiere beim Ausflug - Ende Mai - Anfang Juni
- Quartiersuche durch Beobachtungen am Quartier schwärmender Tiere bzw. von Einflügen in der Morgendämmerung sowie anhand von Soziallauten
- ggfs. Kontrollen von Fledermauskästen
Sommer-, Zwischenquartiere:
- Ausflugszählungen, Feststellung der Quartierstandorte anhand der Sozialrufe
Balz-, Winterquartiere:
- Feststellung der Quartierstandorte anhand der Sozialrufe
Jagdgebiete:
- gute akustische Nachweisbarkeit, Begehungen mit Ultraschalldetektor, Rufaufzeichnungen für anschließende Analyse der Sonagramme
- mindestens 6-8 Begehungen im Zeitraum Ende April bis Anfang September, Begehungsdauer je nach Gebietsgröße mindestens 3 Stunden bis ganznächtlich, wobei stets die Dämmerungsphasen einzubeziehen sind
- je nach Untersuchungsziel langfristige oder regelmäßige ganznächtliche stationäre akustische Aufzeichnungen
- spezielle Untersuchungsanforderungen für Planungen von Windenergieanlagen (6 Begehungen während des Frühjahrszuges, 7 Begehungen in der Wochenstubenzeit, 10 Begehungen während des Herbstzuges sowie langfristige bzw. regelmäßige ganznächtliche stationäre akustische Aufzeichnungen)
- Netzfänge zur Feststellung des Reproduktionsstatus
Sonstige Arten-Attribute
- Besonders störungsempfindlich (TK25-Quadrant-Sechzehntel)
- Zielart Biotopverbund (Konzentration von Vorkommen)
Vorkommen
Langfristiger Bestandstrend
mäßiger Rückgang
Kurzfristiger Bestandstrend
gleichbleibend
Bestand
- 100 bekannte Wochenstubenkolonien, die meist aus 5 – 50 Weibchen bestehen
- 66 bekannte Winterquartiere mit 50 - 426 Tieren
- aktuelle Nachweise auf 357 MTBQ
Verbreitung und Einbürgerung
- Sachsen ist Reproduktions-, Paarungs-, Durchzugs- und Überwinterungsgebiet
- Vorkommen in allen Naturräumen, besonders in den Tieflandsregionen unterhalb 300 m ü. NN sehr häufig
- Wochenstubennachweise vor allem in gewässerreichen Tieflandsregionen
- Winterquartiere verteilen sich vom Tiefland bis in die unteren Berglagen
- während der Zugzeit Beobachtungen in ganz Sachsen vom Tiefland bis zum Erzgebirgskamm
Vorkommenskarte
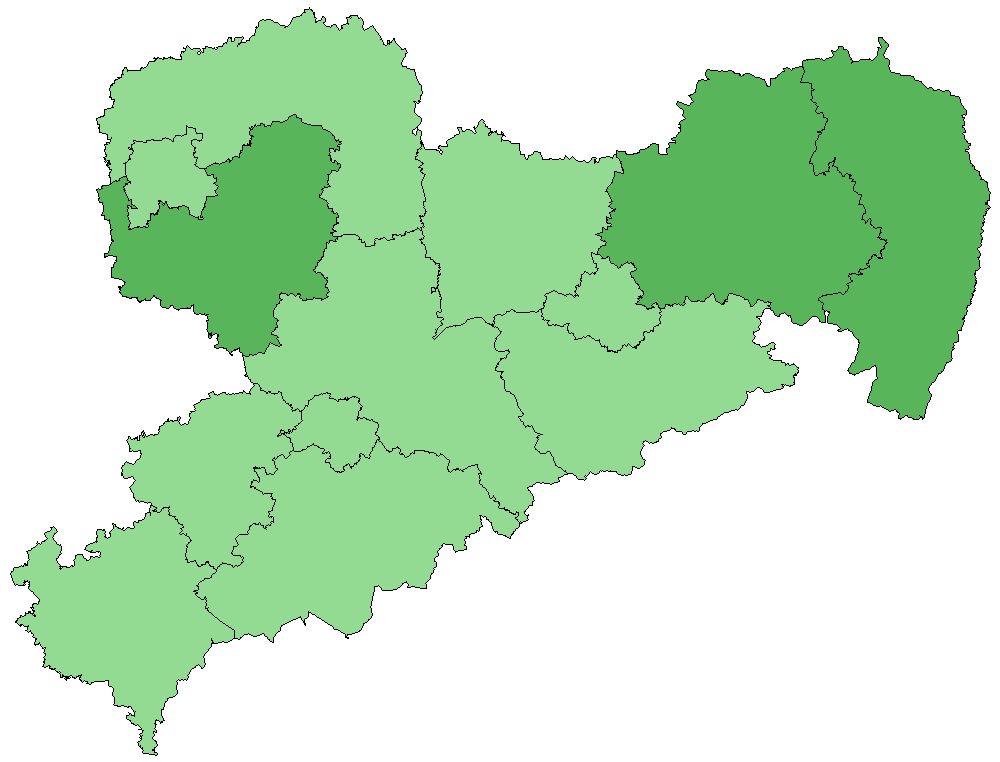
Phänologie
Phänogramm
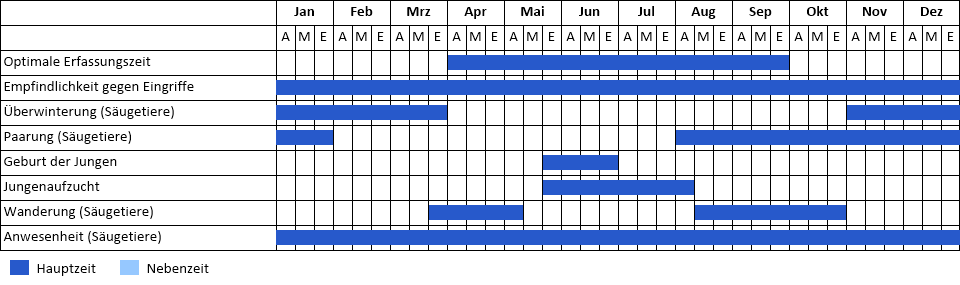
Lebensraum
- breites Lebensraumspektrum, vor allem altholzreiche Laub- und Nadelwälder in Gewässernähe, aber auch gehölzreiche Siedlungen und deren Umgebung sowie Städte
- Jagd über Seen, Teichen und Flußauen sowie über Offenlandflächen (Grün- und Ackerland), dabei oft in Waldnähe oder an Waldrändern, innerhalb von Wäldern meist entlang breiter Schneisen oder über Baumkronenhöhe
- Wochenstuben- und Sommerquartiere sowohl in Baumhöhlen als auch in Bauwerken, darunter Dehnungsfugen in Plattenbauten und Brücken.
- Winterquartiere in Baumhöhlen sowie Fels- oder Mauerspalten
Lebensräume nach Artenschutzrecht
- Fortpflanzungsstätten sind Wochenstubenquartiere in Baumhöhlen oder Bauwerken
- Ruhestätten sind Quartiere in Baumhöhlen oder Bauwerken
- Aufgrund der traditionellen Quartiernutzung gelten diese auch dann als Fortpflanzungs- bzw. Ruhestätten, wenn sie vorübergehend nicht besetzt sind.
- Die lokale Population umfasst eine Wochenstubenkolonie, eine Männchengesellschaft, die Winterschlafgemeinschaft eines Winterquartiers oder die Paarungsgemeinschaft eines Paarungsquartiers
Habitatkomplexe
- Fels-/Gesteins-/Offenbodenbiotope
- Gebäude, Siedlungen
- Gehölze, Baumbestand
- Stillgewässer inkl. Ufer
- Wälder
Habitatkomplexe Reproduktion
- Gebäude, Siedlungen
- Wälder
Management
Handlungsbedarf aus Landessicht
- Landeszielart des Biotopverbundes
Management
- Erhaltung und Förderung höhlenreicher Altbaumbestände mit mindestens 10 Höhlenbäumen pro ha
- Verzicht auf Pestizide in Land- und Forstwirtschaft
- Erhaltung von Quartieren in Bauwerken, ggfs. fledermausgerechte Sanierungen mit fachkundiger Betreuung
Gefährdungen
- Fällung besetzter Quartierbäume während des Winterschlafs oder der Wochenstubenzeit
- Quartierverluste durch forstwirtschaftliche Nutzung
- Quartierverluste im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht
- Zerstörungen von Gebäudequartieren durch Abriss oder nicht fledermausgerechte Sanierung
- Insektizideinsatz in Forst- und Landwirtschaft
- Verringerung der Nahrungsgrundlage durch Zerstörung natürlicher Flussauen
- Betrieb von Windenergieanlagen besonders während der saisonalen Wanderungen
Sonstiges
Literatur
Blohm, T. & G. Heise (2009): Windkraftnutzung und Bestandsentwicklung des Abendseglers Nyctalus noctula (Schreber, 1774), in der Uckermark. - Nyctalus (N.F.) 14: 14-26.
Boye, P. & M. Dietz (2004): Nyctalus noctula (Schreber, 1774). – In: Petersen, B., G. Ellwanger, R. Bless, P. Boye, E. Schröder & A. Ssymank: Das europäische Schutzgebietssystem NATURA 2000, Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland, Bd. 2 Wirbeltiere. – Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz 69 / Bd. 2: 529–536.
Dietz, C., O. v. Helversen & D. Nill (2007): Handbuch der Fledermäuse Europas und Nordwestafrikas. Franckh-Kosmos Verlags GmbH, Stuttgart.
Heise, G. (1985): Zu Vorkommen, Phänologie, Ökologie und Altersstruktur des Abendseglers (Nyctalus noctula) in der Umgebung von Prenzlau/Uckermark. - Nyctalus (N.F.) 2: 133-146.
Heise, G.(1989): Ergebnisse reproduktionsbiologischer Untersuchungen am Abendsegler (Nyctalus noctula) in der Umgebung von Prenzlau/Uckermark. - Nyctalus (N.F.) 3: 17-32.
Jones, G. (1995): Flight performance, echolocation and foraging behaviour in noctule bats Nyctalus noctula. - J. Zoology, London 237: 303-312.
Kronwitter, F. (1988) Population structure, habitat use and activity patterns of the noctule bat, Nyctalus noctula (Chiroptera: Vespertilionidae) revealed by radio-tracking. Myotis 26: 23 - 86.
Meisel, F. (2004): Verlust eines bedeutsamen Winterquartieres für Große Abendsegler. - Mitt. Sächs. Säugetierfreunde: 51-54.
Meschede, A. & K.-G. Heller (2000): Ökologie und Schutz von Fledermäusen in Wäldern. – Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz 66, Hrsg. Bundesamt für Naturschutz.
Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Hrsg.): Atlas der Säugetiere Sachsens. - Naturschutz und Landschaftspflege,
Schmidt, A. (1997): Zu Verbreitung, Bestandsentwicklung und Schutz des Abendseglers (Nyctalus noctula) in Brandenburg. - Nyctalus (N.F.) 6: 365-371.
Schober, W & E. Grimmberger (1998): Die Fledermäuse Europas. - Franckh-Kosmos Verlags GmbH & Co., Stuttgart.
Steffens, R., U. Zöphel & D. Brockmann (2004): 40 Jahre Fledermausmarkierungszentrale Dresden – methodische Hinweise und Ergebnisübersicht. - Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege, 125 S.
Weid, R. (2002): Untersuchungen zum Wanderverhalten des Abendseglers (Nyctalus noctula) in Deutschland. - Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz 71: 233–257.
Bearbeitungsstand und Bearbeiter des Artensteckbriefes
28.11.2010
Ch. Schmidt
; Aktualisierung 17.06.2014 U. Zöphel