Allgemeine Arteninformationen
Kennzeichen
- eine der kleinsten europäischen Fledermausarten
- Rückenfell dunkel- oder rotbraun, Unterseite gelbbraun, Gesichtspartien dunkel, Ohren klein und abgerundet
- Flügelspannweite 18 – 24 cm
- Gewicht 3 – 7 g
- Unterarmlänge 28 – 34,5 mm
Biologie und Ökologie
- Wochenstuben- und Sommerquartiere in Spalten an Gebäuden, Einzeltiere auch hinter der Rinde von Bäumen, die Quartiere werden häufig gewechselt
- Winterquartiere in Gebäuden, unterirdischen Kellern, Felsspalten
- Wochenstubengesellschaften bestehen meist aus 50 – 150 Weibchen
- im Rahmen der Quartiererkundung gelegentlich Einflug größerer Gruppen, die überwiegend aus jungen Zwergfledermäusen bestehen, in Wohnräume (Invasionen), wobei bereits gelandete Tiere durch Soziallaute weitere Artgenossen anlocken
- schneller wendiger Flug, oft entlang linearer Landschaftsstrukturen, bedingt strukturgebunden
- breites Nahrungsspektrum an Fluginsekten mit hohem Anteil an Zweiflüglern
- Jagdgebiete sind maximal 2 Kilometer vom Tagesquartier entfernt
- saisonale Wanderungen sind möglich, jedoch überwintern die meisten Tiere in der Nähe der Sommerquartiere bei einer Entfernung zwischen Sommer- und Winterquartieren von weniger als 20 bis 100 km
Überregionale Verbreitung
- in ganz Europa verbreitet, nördlich bis zum 56. Breitengrad sowie vom Mittelmeerraum bis zum Mittleren Osten
Erhaltungszustand

günstig
Prüfung und Erfassung
Untersuchungsstandards
- Wochenstubenquartiere:
- Zählungen adulter Tiere beim Ausflug - Ende Mai - Anfang Juni, Parallelzählungen bei bekannten Quartierkomplexen
- Quartiersuche durch Gebäudekontrollen und durch Beobachtungen von Einflügen in der Morgendämmerung
Jagdgebiete und Flugwege:
- akustisch gut nachweisbar, Begehungen mit Ultraschalldetektor im Rahmen von Untersuchungen des Gesamtartenspektrums eines Gebietes, Rufaufzeichnungen zeitgedehnt oder in Echtzeit für anschließende Analyse der Sonagramme, Sicherung der Rufbelege
- mindestens 6-8 Begehungen im Zeitraum Ende April bis Anfang September, Begehungsdauer je nach Gebietsgröße mindestens 3 Stunden bis ganznächtlich
- langfristige bzw. regelmäßige ganznächtliche stationäre akustische Aufzeichnungen, z.B. an potenziellen Leitstrukturen
- spezielle Untersuchungsanforderungen für Planungen von Windenergieanlagen (6 Begehungen während des Frühjahrszuges, 7 Begehungen in der Wochenstubenzeit, 10 Begehungen während des Herbstzuges sowie langfristige bzw. regelmäßige ganznächtliche stationäre akustische Aufzeichnungen)
-Netzfänge zur Feststellung des Reproduktionsstatus
- Wochenstubenquartiere:
- Zählungen adulter Tiere beim Ausflug - Ende Mai - Anfang Juni, Parallelzählungen bei bekannten Quartierkomplexen
- Quartiersuche durch Gebäudekontrollen und durch Beobachtungen von Einflügen in der Morgendämmerung
Jagdgebiete und Flugwege:
- akustisch gut nachweisbar, Begehungen mit Ultraschalldetektor im Rahmen von Untersuchungen des Gesamtartenspektrums eines Gebietes, Rufaufzeichnungen für anschließende Analyse der Sonagramme, Sicherung der Rufbelege
- mindestens 6-8 Begehungen im Zeitraum Ende April bis Anfang September, Begehungsdauer je nach Gebietsgröße mindestens 3 Stunden bis ganznächtlich
- langfristige bzw. regelmäßige ganznächtliche stationäre akustische Aufzeichnungen, z.B. an potenziellen Leitstrukturen
- spezielle Untersuchungsanforderungen für Planungen von Windenergieanlagen (6 Begehungen während des Frühjahrszuges, 7 Begehungen in der Wochenstubenzeit, 10 Begehungen während des Herbstzuges sowie langfristige bzw. regelmäßige ganznächtliche stationäre akustische Aufzeichnungen)
- Netzfänge zur Feststellung des Reproduktionsstatus
Sonstige Arten-Attribute
- Besonders störungsempfindlich (TK25-Quadrant-Sechzehntel)
Vorkommen
Status Etablierung
Indigene, Ureinheimische (Reproduktion)
Langfristiger Bestandstrend
- Daten ungenügend
- starker Rückgang
Kurzfristiger Bestandstrend
- Abnahme, Ausmaß unbekannt
- Abnahme mäßig oder im Ausmaß unbekannt
Bestand
- - mehr als 100 bekannte Wochenstubenkolonien mit meist 20 – 200 Weibchen
- wenige bekannte Winterquartiere, in denen in der Regel einzelne Tiere überwintern
- aktuelle Nachweise auf 255 MTBQ
- mehr als 100 bekannte Wochenstubenkolonien mit meist 20 – 200 Weibchen
- wenige bekannte Winterquartiere, in denen in der Regel einzelne Tiere überwintern
- aktuelle Nachweise auf 255 MTBQ
Verbreitung und Einbürgerung
- - in Sachsen weit verbreitet und in allen Naturräumen mit Ausnahme der höheren Berglagen anzutreffen
- Wochenstubennachweise vor allem im Tief- und Hügelland
- als Überwinterungsgebiet ist besonders die an Felsspalten reiche Sächsische Schweiz von Bedeutung
- in Sachsen weit verbreitet und in allen Naturräumen mit Ausnahme der höheren Berglagen anzutreffen
- Wochenstubennachweise vor allem im Tief- und Hügelland
- als Überwinterungsgebiet ist besonders die an Felsspalten reiche Sächsische Schweiz von Bedeutung
Vorkommenskarte

Phänologie
Phänogramm
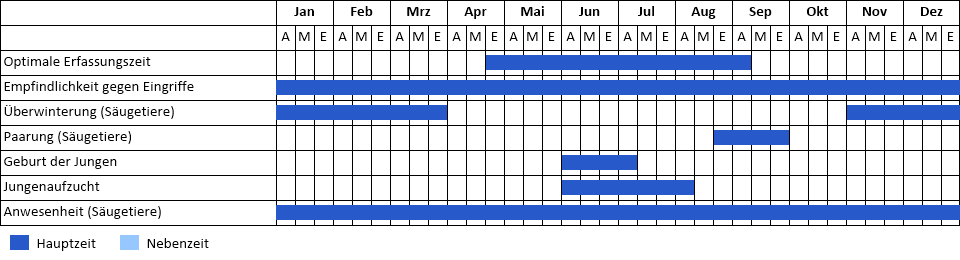
Lebensraum
- sehr breites Lebensraumspektrum, sowohl in Nadel-, Misch- und Laubwäldern als auch in dörflichen Siedlungen und innerhalb von Städten, Jagd oft an gewässernahen Gehölzbeständen
- Wochenstuben- und Sommerquartiere in Spalten in und an Gebäuden (Mauerspalten, Fassadenverkleidungen), häufig in Dehnungsfugen von Plattenbauten
- Winterquartiere ober- und unterirdisch in Gebäuden sowie in Felsspalten
Lebensräume nach Artenschutzrecht
- Fortpflanzungsstätten sind Wochenstubenquartiere in Gebäuden
- Ruhestätten sind Quartiere in Gebäuden, unterirdischen Bauwerken, Baumquartieren und Fledermauskästen
- Aufgrund der traditionellen Quartiernutzung gelten diese auch dann als Fortpflanzungs- bzw. Ruhestätten, wenn sie vorübergehend nicht besetzt sind.
- Die lokale Population umfasst eine Wochenstubenkolonie bzw. die Winterschlafgemeinschaft eines Winterquartiers
Habitatkomplexe
- Fels-/Gesteins-/Offenbodenbiotope
- Fließgewässer, Quellen
- Gebäude, Siedlungen
- Gehölze, Baumbestand
- Grünland, Grünanlagen
- Höhlen, Bergwerksanlagen
- Ruderalfluren, Brachen
- Stillgewässer inkl. Ufer
- Wälder
Habitatkomplexe Reproduktion
Management
- Erhaltung von Quartieren in Bauwerken, ggfs. fledermausgerechte Sanierungen mit fachkundiger Betreuung
- Verzicht auf Pestizide in Land- und Forstwirtschaft
Gefährdungen
- Zerstörungen von Gebäudequartieren durch Abriss oder nicht fledermausgerechte Sanierung
- Insektizideinsatz in Forst- und Landwirtschaft
- Betrieb von Windenergieanlagen in der Nähe von Wald- und Gehölzbeständen
Sonstiges
Literatur
Meinig, H. & P. Boye (2004): Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774). - In: Petersen, B., G. Ellwanger, R. Bless, P. Boye, E. Schröder & A. Ssymank: Das europäische Schutzgebietssystem NATURA 2000, Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland, Bd. 2 Wirbeltiere. – Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz 69 / Bd. 2: S. 570-575.
Dietz, C., O. v. Helversen & D. Nill (2007): Handbuch der Fledermäuse Europas und Nordwestafrikas. Franckh-Kosmos Verlags GmbH, Stuttgart.
Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Hrsg.): Atlas der Säugetiere Sachsens. - Naturschutz und Landschaftspflege,
Schmidt, C. (2007): Summer Distribution of Pipistrellus pipistrellus, P. pygmaeus and P. nathusii in the Oberlausitz Mountains and the Oberlausitz Pond landscape area - preliminary results. - Ber. Naturforsch. Ges. Oberlausitz 15: 37-42.
Schober, W & E. Grimmberger (1998): Die Fledermäuse Europas. - Franckh-Kosmos Verlags GmbH & Co., Stuttgart.
Simon, M., Hüttenbügel, S. & J. Smit-Viergutz (2004): Ökologie und Schutz von Fledermäusen in Dörfern und Städten. Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung des Erprobungs- und Entwicklungsvorhabens "Schaffung eines Quartierverbundes für Gebäude bewohnende Fledermausarten durch Sicherung und Ergänzung des bestehenden Quartierangebots in und an Gebäuden". - Schriftenr. Landschaftspfl. Naturschutz 76: 1-275.
Steffens, R., U. Zöphel & D. Brockmann (2004): 40 Jahre Fledermausmarkierungszentrale Dresden – methodische Hinweise und Ergebnisübersicht. - Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege, 125 S.
Bearbeitungsstand und Bearbeiter des Artensteckbriefes
28.11.2010
Ch. Schmidt
; Aktualisierung 17.06.2014 U. Zöphel