Allgemeine Arteninformationen
Taxonomie
- in den 1990-er Jahren anhand von genetischen Merkmalen sowie von Echoortungsrufen (bei 55 kHz im Gegensatz zur tiefer rufenden Zwergfledermaus) beschrieben
Kennzeichen
- eine der kleinsten mitteleuropäischen Fledermausarten
- Rückenfell sandbraun, Unterseite hellbraun, helle abgerundete Ohren
- Flügelspannweite 18 – 24 cm
- Gewicht 4 – 7 g
- Unterarmlänge 27,7 – 32,3 mm
Biologie und Ökologie
- Wochenstubenquartiere in Spalten in und an Gebäuden sowie in Baumhöhlen
- Wochenstubenkolonien können bis 1.000 adulte Weibchen umfassen
- Paarungsquartiere in Baumhöhlen, Fledermauskästen und Gebäuden
- Winterquartiere oberirdisch in Gebäuden und Baumhöhlen
- Jagdgebiete vor allem an Gewässerrändern
- Beutetiere sind vor allem Zweiflügler, Hautflügler und Netzflügler
- mittlere Entfernung zwischen Jagdgebiet und Tagesquartier 1,7 km
- bisher wenige Markierungsergebnisse, möglicherweise saisonaler Langstreckenzug zwischen Sommer- und Winterquartier
Überregionale Verbreitung
- ganz Europa vom Mittelmeerraum bis etwa zum 63. Breitengrad, ostwärts wahrscheinlich bis nach Nordasien
- in Deutschland weit verbreitet, Nachweise liegen aus den meisten Bundesländern vor
Erhaltungszustand

ungünstig-unzureichend
Prüfung und Erfassung
Relevanz bei Eingriffen
- Forstwirtschaft
- Straßenbau
- Windkraft
Untersuchungsstandards
Wochenstubenquartiere:
- Zählungen adulter Tiere beim Ausflug - Ende Mai - Anfang Juni
- ggfs. Kastenkontrollen
Jagdgebiete und Flugwege:
- akustisch gut nachweisbar, Begehungen mit Ultraschalldetektor im Rahmen von Untersuchungen des Gesamtartenspektrums eines Gebietes, Rufaufzeichnungen für anschließende Analyse der Sonagramme, Sicherung der Rufbelege
- mindestens 6-8 Begehungen im Zeitraum Ende April bis Anfang September, Begehungsdauer je nach Gebietsgröße mindestens 3 Stunden bis ganznächtlich
- langfristige bzw. regelmäßige ganznächtliche stationäre akustische Aufzeichnungen, z.B. an potenziellen Leitstrukturen
- spezielle Untersuchungsanforderungen für Planungen von Windenergieanlagen (6 Begehungen während des Frühjahrszuges, 7 Begehungen in der Wochenstubenzeit, 10 Begehungen während des Herbstzuges sowie langfristige bzw. regelmäßige ganznächtliche stationäre akustische Aufzeichnungen)
- Netzfänge zur Feststellung des Reproduktionsstatus
- zusätzlich Telemetrie zur Suche nach Quartieren und Untersuchung der Raumnutzung
Sonstige Arten-Attribute
- Besonders störungsempfindlich (TK25-Quadrant-Sechzehntel)
Vorkommen
Langfristiger Bestandstrend
- Daten ungenügend
- mäßiger Rückgang
Kurzfristiger Bestandstrend
Daten ungenügend
Bestand
- 10 bekannte Wochenstubenkolonien umfassen 20 – 231 Alt- und Jungtiere
- 1 bekanntes Winterquartier in der Sächsischen Schweiz
- aktuelle Nachweise auf 39 MTBQ
Verbreitung und Einbürgerung
- Sachsen ist Reproduktions- und Überwinterungsgebiet
- Vorkommen in allen Naturräumen, der Schwerpunkt liegt jedoch im Tiefland
- Wochenstubennachweise in Nordwestsachsen, in der Großenhainer Pflege, im Oberlausitzer Heide- und Teichgebiet sowie im Westlausitzer Hügel- und Bergland
- Winternachweise bisher nur in der Sächsischen Schweiz
Vorkommenskarte
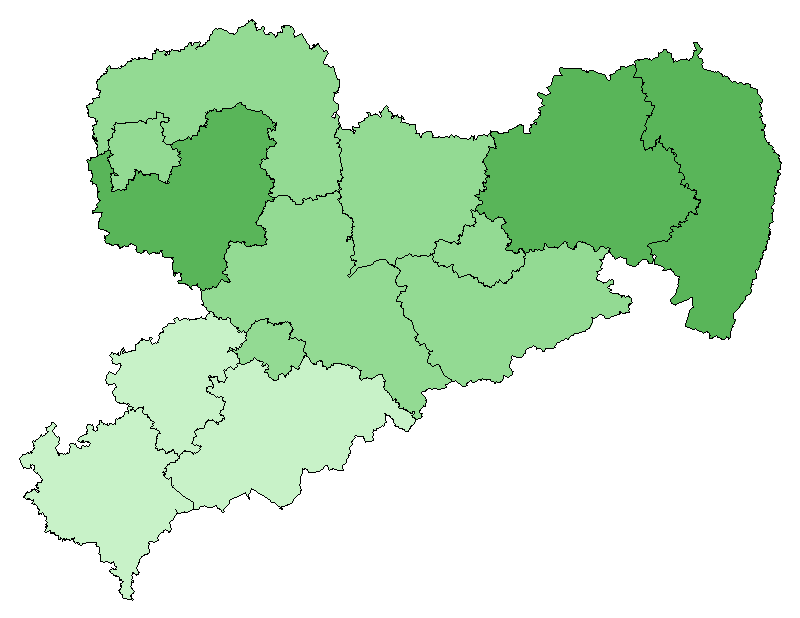
Phänologie
Phänogramm
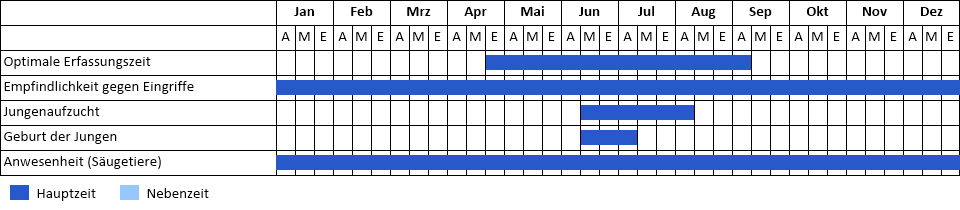
Lebensraum
- gewässer- und waldreiche Gebiete, von Laub- oder Kiefernwäldern umgebene Teichgruppen, Flussauen mit Auwaldresten, Flusstäler mit angrenzenden Hangwäldern
- Wochenstubenquartiere in Spalten an Gebäuden (Fassaden und Schornsteinverkleidungen, Sims- und Rolladenkästen, Schindeldach)
- Paarungsquartiere in Fledermauskästen und hinter loser Borke
- bisher nur ein bekanntes Winterquartier in einer Felsspalte der Sächsischen Schweiz
Habitatkomplexe
- Fließgewässer, Quellen
- Gebäude, Siedlungen
- Gehölze, Baumbestand
- Stillgewässer inkl. Ufer
- Wälder
Habitatkomplexe Reproduktion
- Gebäude, Siedlungen
- Wälder
Management
- Erhaltung von Quartieren in Bauwerken, ggfs. fledermausgerechte Sanierungen mit fachkundiger Betreuung
- Verzicht auf Pestizide in Land- und Forstwirtschaft
- Erhaltung bzw. Renaturierung natürlicher Au- und Bruchwälder
- Erhaltung und Förderung höhlenreicher Altbaumbestände mit mindestens 10 Höhlenbäumen pro ha
Gefährdungen
- Zerstörungen von Gebäudequartieren durch Abriss oder nicht fledermausgerechte Sanierung
- Insektizideinsatz in Forst- und Landwirtschaft
- Quartierverluste durch forstwirtschaftliche Nutzung
- Betrieb von Windenergieanlagen in der Nähe von Wald- und Gehölzbeständen
Sonstiges
Literatur
Barlow, K.E. (1997): The diets of two phonic types of the bat Pipistrellus pipistrellus in Britain. – J. Zool. Lond. 243: 597 – 609.
Barlow, K.E. & G. Jones (1997): Differences in songflight calls and social calls between two phonic types of the vespertilionid bat Pipistrellus pipistrellus. – J. Zool. Lond. 241: 315 – 324.
Barlow, K.E. & G. Jones (1997): Roosts, echolocation calls and wing morphology of two phonic types of Pipistrellus pipistrellus. – Z. Säugetierkunde 64: 257 – 268.
Barrett, E.M., M.W. Bruford, T.M. Burland, G. Jones, P.A. Racey & R.K. Wayne (1995): Characterization of mitochondrial DNA variability within the microchiropteran genus Pipistrellus: approches and application. – Symp. Zool. Soc. Lond. 67: 377 – 386.
Barrett, E.M., R. Deaville, T.M. Burland, M.W. Bruford, G. Jones, P.A. Racey & R.K. Wayne (1997): DNA answers the call of pipistrelle bat species. – Nature 387: 138 – 139.
Bartonička T. & Z. Řehák (2004): Flight activity and habitat use of Pipistrellus pygmaeus in a floodplain forest. - Mammalia 68 (4): 365-375.
Dolch, D. & J. Teubner (2004): Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) und Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus) in Brandenburg. – Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg 13 (1): 27 – 31.
Davidson-Watt, I. & G. Jones (2006): Differences in foraging behaviour between Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) and Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825). - Journal of Zoology, London 268: 55-62.
Dietz, C., O. v. Helversen & D. Nill (2007): Handbuch der Fledermäuse Europas und Nordwestafrikas. Franckh-Kosmos Verlags GmbH, Stuttgart.
Oakeley, S.F. & G. Jones (1998): Habitat around maternity roosts of the 55 kHz phonic type of pipistrelle bats (Pipistrellus pipistrellus). – J. Zool. Lond. 245: 222 – 228.
Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Hrsg.): Atlas der Säugetiere Sachsens. - Naturschutz und Landschaftspflege,
Steffens, R., U. Zöphel & D. Brockmann (2004): 40 Jahre Fledermausmarkierungszentrale Dresden – methodische Hinweise und Ergebnisübersicht. - Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege, 125 S.
Zöphel, U., T. Ziegler, A. Feiler & S. Pocha (2002): Erste Nachweise der Mückenfledermaus, Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825), für Sachsen (Mammalia: Chiroptera: Vespertilionidae). – Faunist. Abh. Mus. Tierk. Dresden 22, 26: 411 – 422.
Bearbeitungsstand und Bearbeiter des Artensteckbriefes
28.11.2010
Ch. Schmidt
; Aktualisierung 17.06.2014 U. Zöphel